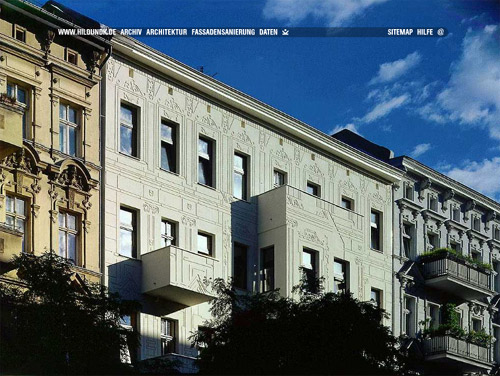|
Eine junge Künstlerin bekommt einen Preis für eine Papiertapete.
Ein Architekturbüro wird berühmt mit einem Haus, das aussieht,
als hätten es die Architekten nicht mauern, sondern stricken lassen.
Was war passiert? Auf weißen Wänden sprießen plötzlich
wieder Muster und Ornamente, als hätte es Adolf Loos nie gegeben,
den großen Ornamentenfeind, der Anfang des 20. Jahrhunderts erklärt
hatte, es mache "die größe unserer zeit aus, daß sie
nicht imstande ist, ein neues ornament hervorzubringen. wir haben uns
zur ornamentlosigkeit durchgerungen. die zeit ist nah, die erfüllung
wartet unser." Loos, der das von Gründerzeitschnörkeln gebeutelte
Volk durch die Fluten von Pilastern, Gesimsen, Halbreliefs, Puttengeflatter
und Gurkengirlanden ins gelobte Land des Funktionalismus führen
wollte: Loos haßte das Ornament so sehr, daß er seine Bergpredigt
des modernen Geschmacks vorsichtshalber in kleinen Buchstaben schrieb,
als wäre der große Buchstabe selbst schon ein dubioses Ornament
der Sprache. Seitdem mieden Architekten durch alle Stilentwicklungen
hindurch eindeutige Ornamente, als seien sie Teufelswerk. Zwar wagte
es eine kleine Schar von postmodernen Querulanten, ein paar Loopings
im Luftraum des guten Geschmacks zu drehen und ihre modernen Kisten
mit Säulen und gesprengten Giebeln zu dekorieren - aber das war
nur eine ironische Girlande, die bald wieder abgehängt wurde, um
der "Neuen Einfachheit" Platz zu machen, die strenger, blutleerer und
vor allem luxuriöser, als Loos es je gewollt hätte, den Kult
formaler Reinheit zelebrierte. In ihr wurde das moderne Reinheitsgebot,
hinter dem die soziale Utopie schöner neuer Architektur für
alle steckte, zum luxuriösen Stil; keine Seidentapete war so teuer
wie der Beton der Neuen Einfachheit.
Vielleicht ist es diese überfeinerte Reinheitsvision, die seit
einiger Zeit in Kunst und Architektur erstaunliche Reaktionen provoziert:
Künstler tauchen auf, die mit dem Verpöntesten schlechthin,
mit Tapeten und Fassadenschmuck, nicht mehr ironisch, sondern ganz ernsthaft
spielen - und die Kritiker in ein Interpretationsloch stürzen,
aus dem sie kaum mehr herauskommen.
Zum Beispiel Tapeten. Sie waren schon immer die häßlichen
Schwestern des Kunstwerks. Letztlich war das Fresko die letzte Form
der Wandgestaltung, die es mit dem Tafelbild aufnehmen konnte; die Dekortapete
war ihr kleinbürgerlicher Nachfolger, eine industriell hergestellte,
billige Schwundstufe der künstlerischen Wanddekoration. Papiertapeten,
ob sie nun abstrakte Kunst nachäfften oder rotglühende Sonnenuntergänge
abbildeten, waren immer Zeugnisse uneingestandener Sehnsüchte nach
etwas Besserem, nach den seidenbespannten Wänden der Paläste,
nach geographisch und kulturell unerreichbaren Zielen. Nur eine kleine
Stilavantgarde flüchtete Anfang der neunziger Jahre aus den weißen
Räumen der Neuen Einfachheit - und fand mit einer Zärtlichkeit
gegenüber den großen, lächerlich gewordenen Gesten der
Vergangenheit, mit dem Gefühl, das Susan Sontag einmal als "Camp"
bezeichnete, Gefallen an den schrillen Tapeten der frühen Siebziger.
Genau diesen Bruch im Stilbewußtsein reflektiert die Künstlerin
Elke Haarer mit ihrem Tapetenkunstwerk "Giverny", das nur auf den ersten
Blick an die muffige Tapetenidylle kleinbürgerlicher Wohnungen
erinnert: Das Muster, das zunächst wie eine Abstraktion von Monets
Seerosen aussieht, setzt sich aus Adidas-Symbolen zusammen; erniedrigte
Hochkultur und veredelter Pop verschmelzen in der Adidas-Seerose zu
einer neuen Ikone.

Wohnhaus vom Büro Hild und K in Aggstall 2000
Das Spiel mit dem Modischen und dem Demodierten, dem Strengen und dem
Gemütlichen treiben auch die Münchner Architekten des Büros
Hild und K. Sie bauten vor drei Jahren in Aggstall ein kleines Spitzdachhaus
mit rautenförmig gemauertem Muster, das aussah, als hätte
man ihm einen Norwegerpullover aus Steinfäden umgehängt. Kritiker
und Kollegen waren verschreckt: Spitzdächer galten als Zeichen
von Provinzialität, Muster auch. Obwohl deutlich geschmackswidrig,
sah das Haus aber nicht bieder genug aus, um als Regionalkitsch abqualifiziert
zu werden. Was also dann? Waren Dach und Fassaden ironisch, oder meinen
die Architekten es ernst? Und war dieser nonchalante Ernst, mit dem
da Muster in die Fassade gemauert wurden, am Ende doppelte Ironie: Nämlich
die ihrerseits ironische Abkehr vom offensichtlich ironisch-historischen
Zitatquark der Postmoderne?
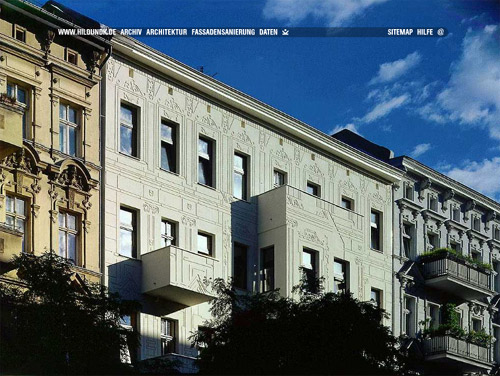
www.hildundk.de
- Berlin 1999 - Neuer Fassadendekor
Während den Exegeten der Architekturszene noch die Köpfe rauchten,
holten Hild und K zu weiteren Schlägen aus. In Berlin renovierten
sie ein Haus der Gründerzeit, dessen Putz nach dem Krieg abgeschlagen
worden war, auf besondere Weise. Die Originalzeichnung für das Fassadendekor
wurde im Computer vergrößert; dadurch wurden die Linien unscharf
und bröselig. Diese enorm vergrößerte, leicht unscharfe
Zeichnung wurde per Laser aus einem Kunststoff geschnitten und durch eine
Schablonenputztechnik auf die Hauswand übertragen. Auf der Fassade
ist also eine vergrößerte Zeichnung zu sehen - die gleichzeitig
Skulptur ist. Die Fassade ist ein Vexierbild: Das Dekor ist einerseits
nur Projektion, andererseits - weil ins Material gefräst - auch dreidimensional;
eine Reliefzeichnung, die zwischen Abbild und Original oszilliert, ein
halbes Trompe-l'oeil, das die Vergangenheit in die Fassade zurückzaubert,
ohne sie nachzubilden. Wie Gewächs wuchern die Zeichnungen über
die einst geglättete Fassade und wirken wie ein neuer Jugendstil:
Der Entwurf kriecht als Gewächs über den fertigen Bau.
Die Fassade ist die Rückkehr des Staunens und des Rätsels, der
Architektur als Erzählung und Labyrinth im Stadtbild. Die Stucklabyrinthe
der Gründerzeitbauten wirkten wie eine Metapher der chaotischen Verschränkungen
und Entwicklungen der Biographien ihrer Bewohner. Das neue Spiel mit dem
Dekor ist eine Abwehrreaktion auf jenen Reduktionismus, der als Neue Einfachheit
etwa zehn Jahre lang Architektur und Design bestimmte. "Noch die ästhetisch
hochgezüchtete Allergie gegen Kitsch, Ornament, Überflüssiges,
dem Luxus sich Näherndes hat auch den Aspekt von Barbarei", schrieb
Adorno in der "Ästhetischen Theorie"; mittlerweile ist die Allergie
gegen den Kitsch des Ornaments selbst kitschig geworden: Der Versuch,
alles noch reiner und weißer erscheinen zu lassen, noch härter
und unsentimentaler, erfordert von Designern und Architekten stilistische
Verrenkungen, die selbst enorm schnörkelig sind.
Der architektonische Minimalismus der Neunziger war ein Leerlauf der Moderne:
Weil man nicht wußte, wie die Ästhetik der Gegenwart aussehen
könnte, überfeinerte man die Ästhetik der klassischen Moderne,
feilte an ihr herum, bis nichts mehr übrigblieb. Die kahlen Räume
der Zweiten Moderne entsprachen in ihrer anämischen Farblosigkeit
den gespenstisch dürren Supermodels, die, wie Kate Moss in der Reklame
von Calvin Klein, im weißen Nebel des guten Geschmacks verschwanden.
Alles mußte rein, pur, "Purity" sein; die Ästhetik der Neunziger
war so kaltweiß und blutarm, so dürr und überbelichtet,
daß sie über kurz oder lang unsichtbar werden mußte.
In dieses Nichts der Selbstauflösung stößt die Renaissance
des Dekors. Auch Rem Koolhaas und Herzog & de Meuron entdecken in
ihren Bauten den ornamentalen Reiz moderner Formen - darin sind sie Schüler
von Oscar Niemeyer, der die Formen der Moderne schon in den Fünfzigern
zu gigantischen Ornamenten verschmolz. Auch Hild und K führen bei
ihrem soeben fertiggestellten Parkhaus in München-Riem vor, wie eine
wellenförmige Betonfassade als modernes Ornament wirken kann. Die
neue Opulenz verhält sich zum blutarmen Minimalismus der Neunziger
wie der laute, zitatfreudige Pop der Sechziger zum erstarrten Modernismus
der Nachkriegszeit. Die Geschichte wiederholt sich: Die Spuren an der
Wand erzählen davon. NIKLAS MAAK
Text: Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung,
26.10.2003, Nr. 43 / Seite 28
zurück zu Gesamtkunstwerk Neumarkt
Dresden |