| |

Dresden
Altstadt zu Ende des Mittelalters (undatiert)
1 = der von der mittelalterlichen Stadtmauer umgebene Jüdenhof
2 = Jüdenhaus
3 = Frauentor, welches 2003 unterm Neumarkt ausgegraben wurde
4 = gotische Frauenkirche inmitten des alten Friedhofes
Mittelalter
Der sogenannte
Jüdenhof lag im Mittelalter direkt an der alten Stadtmauer ganz
in der Nähe des Frauentores, welches zur dörflichen Frauenvorstadt
führte. Während der Neumarkt im Mittelalter als Platz noch
nicht ausgebildet war, ist der erstmals 1416 erwähnte Jüdenhof
bereits als platzartiger, freier Stadtraum erkennbar. Die städtische
Abtrennung und Randlage des jüdischen Hofes lässt allerdings
nicht auf eine öffentliche Nutzung als Markt schließen.
Der Jüdenhof erhielt offenbar seine Bezeichnung durch das bis
1411 offiziell an diesem Ort sich befindende jüdische Gemeindehaus.
Synagoge
Dieses vermutlich längliche Gebäude an der Stadtmauer war
im Jüdenhof gelegen, doch abgetrennt von der stark frequentierten
Frauenstraße. Die genaue Form dieser frühen Synagoge lässt
sich nicht mehr rekonstruieren. Aber vage Anhaltspunkte gibt es durch
Forschungen über frühe Synagogen nach dem Zerfall des römischen
Reiches. So ist es wahrscheinlich, dass frühmittelalterliche
jüdische Gemeinden die Form der typischen, römischen Mehrzweckhalle,
die Basilika, für ihren Versammlungsort verwendeten - mit Umgang,
Empore, Apsis - ohne jede schmückende Abbildung einer Gottesverehrung
(Bildlosigkeit des jüdischen Glaubens).
Allerdings war und ist die jüdische Synagoge auch ein multifunktionaler
Ort, der auch als Gemeindehaus, Talmudschule, Mikwe (Ritualbad), Tanzhaus
oder Hospital etc. genutzt wurde. Im jüdischen Religionsgesetzbuch,
der sogenannten Halacha, gibt es genaue Vorschriften, wie eine Synagoge
zu errichten war (ist). So bestand eine Synagoge aus einem Zentralraum
und einem Vorderhaus, von dem aus man zur Straße kam. Den Vorschriften
nach durfte sie nicht an andere Häuser angrenzen. Östlich (nach
Jerusalem) war der heilige Schrein mit den Thorarollen aufbewahrt.
Höchstwahrscheinlich befand sich auch in Dresden vor der Synagoge
ein sogen. jüdischer "Schulhof", ein Platz, an dem
Trauungen, aber auch Rechtsprechungen innerhalb der Gemeinde abgehalten
wurden. Dieser Schulhof bildete den Grundstein für den Jüdenhof.
Natürlich ist es völlig unklar, ob in der mittelalterlichen
Dresdner Synagoge alle Funktionen untergebracht waren. Möglich
ist auch, dass sich diese auf verschiedene Gebäude verteilten.
Archäologische Grabungen auf und um den Jüdenhof könnten
weiteres Licht in die frühe jüdische Geschichte an dieser
Stelle bringen.
Auf die jüdische Geschichte in Dresdens Altstadt verweist auch
der Name Judengasse (Jodyngasse - die spätere Schössergasse).
Solche "Judenhöfe" waren im Mittelalter nichts Ungewöhnliches.
Man findet sie noch immer in Eisleben, Perleberg, in Stendal oder
in Berlin. In der Hauptstadt laufen derzeit (2003) ebenfalls Planungen
für eine "kritische Rekonstruktion" durch kleinmaßstäbliches
Bauen des "Großen Jüdenhofes" an der Jüdenstraße/
Molkenmarkt, der allerdings wie der Dresdner Jüdenhof kein Ghetto,
sondern eine offene Ansiedlung war.
Nach der Vertreibung der Dresdner Juden 1430 wurde ein Gewandhaus
1453 in der vom Rat der Stadt erworbenen Judenschule bzw. Synagoge
eingerichtet - mit Gewandbänken für Tuchmacher, Rüstkammer,
Getreidespeicher und Brauhaus. Nach einem erneuten Umbau 1553- 58
wurden auch die Fleischbänke hier untergebracht.
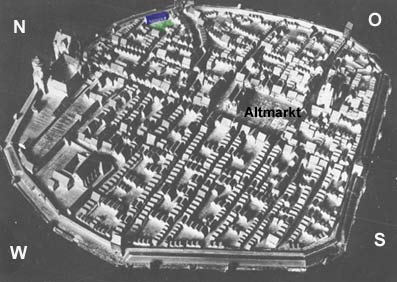
Holzmodell Dresden 1521 (Blau: Jüdenhaus, grün: Jüdenhof
als freier, städtischer Raum - gut zu erkennen: Frauenstraße,
die zum Frauentor in die Frauenvorstadt führte)

Stadtplan Dresden 1529 (an der Stelle des Blauen J gibt die Legende
des Planes "Jüdenhof" an.) Vom länglichen Jüdenhaus
ist anscheinend nur noch ein Rest des zum Gewandhaus umgebauten Gebäudes
geblieben. Mehrere Gebäude gruppieren sich unregelmäßig
um den Platz.
Renaissance
Mit dem Abbruch der alten Stadtmauer 1546 - 56 und dem Bau einer neuzeitlichen
Stadtbefestigung durch Caspar Voigt von Wierandt, die nun auch die
Frauenvorstadt mit einbezog, entstand neuer Bauplatz. Auf diesem gewonnenen
Raum ließ Kurfürst August als Erweiterung des Schlosskomplexes
durch Paul Buchner ab 1586 den kurfürstlichen Pferdestall als
prachtvollen Renaissancebau mit Innenhof (das heutige Johanneum)
errichten. Die sich anschließende Bogenhalle des Langen Ganges
folgte genau der abgetragenen Stadtmauer.

Johanneum, ehem. Kurfürstlicher Stall Dresden, Renaissance-Säulenhalle
Westseite, Aufn. 1935
Gegenüber dem opulenten, mit einem Sgraffitto verzierten "Churfürstlichen
Stall" sollte nach Willen des Kurfürsten Christian I. ein
repräsentatives Gewandhaus entstehen, der das alte Rathaus auf
dem Altmarkt ersetzen könnte. Das alte Gewandhaus im Gebäude
der ehemaligen Synagoge störte, da es zu nah am Stallhaus stand
und wurde deswegen in Teilen abgerissen. In einer alten Chronik heißt
es: "Von alten Zeiten hat ein großes Haus gestanden
/ welches man der JUDEN=HOF / oder wie etliche der JUDEN SYNAGOG geheissen
/ welches aber nach Abschaffung der Juden jederzeit zu einem gemeinen Brauhaus gebraucht worden und so lange gestanden biss man den Chur=Fürstlichen
Stall gebauet / da dann dieses Haus / zu Erlangung eines freyen Prospects,
abgebrochen werden müssen, also daß nicht mehr davon übrig blieben, als der obgedachte Brunnen und der Name des Jüden-Hofs."
Durch den plötzlichen Tod Christian I. 1591 gerieten die Planungen
wesentlich schlichter. Der Rat der Stadt nutzte offenbar ebenfalls
den stehengebliebenen Rest des ehemaligen Jüdenhauses (Brauhaus) und ließ
diesen zu einem neuen einfachen Gewandhaus, ebenfalls von Buchner,
umbauen. Zum "Neuen Markt" hin hatte das zweistöckige,
schmuckarme Gebäude ein hohes Satteldach und drei Giebel zu.
1791 wurde es aus städtebaulichen Erwägungen abgebrochen.
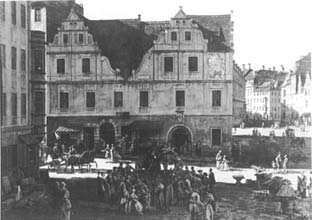
Altes Gewandhaus, Ansicht von der Moritzstraße (ganz links Runderker
vom Schützhaus) - Ausschnitt aus dem Gemälde von Canaletto
"Der Neumarkt zu Dresden" - 1749
Platzschöpfung der Renaissance
Wie bildete sich nun aus den beiden neuen Gebäuden (Stallhof
und Gewandhaus) der neue Platz Jüdenhof? Naheliegend wurde die
bereits vorhandene Windische Gasse (später Galeriestraße)
als westliche Platzfront zum neuen Stadtraum verlängert. Die
dritte Platzkante bildeten Renaissancebürgerhäuser, die
an das neue Gewandhaus anschloßen und zwischen 1590 und 1650
errichtet wurden. Innerhalb eines halben Jahrhunderts hatte sich aus
dem unklaren Ort des mittelalterlichen Jüdenhofs ein geordneter,
klar umrissener, fast rechteckiger Stadtplatz herausgebildet, der
im Gegensatz zum ebenfalls neu entstandenen Neumarkt einen ganz eigenen
intimen Reiz ausstrahlte. Entstanden war ein gleichmäßiger
und wohlproportionierter Platz ganz im Sinne der symmetrischen Idealstadt
der Renaissance mit einem starken Hang zur Geometrisierung.
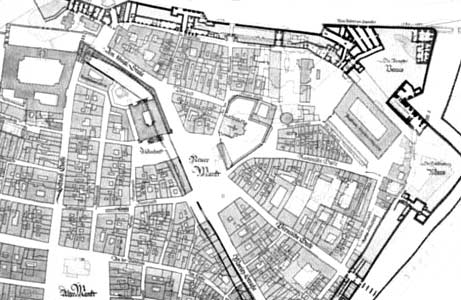
"Plan der Festung Dresden im Zustand 1721 auf den heutigen Zustand
(1931) bezogen"
Die mittelalterliche Stadtmauer ist deutlich zu erkennen. Das Gewandhaus
stand genau auf der alten Festungsanlage.
Barock
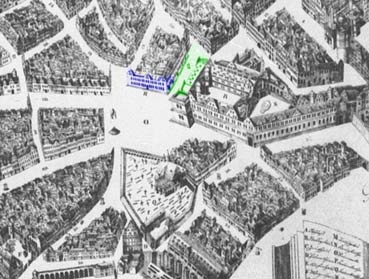
Stadtplan 1633 (grün Jüdenhof, blau: altes Gewandhaus)
Der Stadtplan von 1633 zeigt noch die typischen hohen Renaissancegiebel
über das gesamte Stadtgebeit verteilt. Auch auf den Jüdenhof
wurden nach und nach die hochgiebeligen Bürgerhäuser durch
barocke Gebäude mit Mansarddächern ersetzt, so das berühmte
Dinglingerhaus oder das Regimenthaus, beide von 1710.
Im 18.
Jahrhundert gab es jede Menge Planungen für den Neubau eines
Gewandhauses in barocker Formensprache - so von Pöppelmann, Fehre,
Krubsacius u.a., die jedoch alle nicht verwirklicht wurden. Stattdessen
wurde das alte, in den Neumarkt hineinragende Gewandhaus abgerissen,
um dem Neumarkt eine klarere Ordnung zu geben, dem Jüdenhof eine
gewisse Enge zu nehmen und ihn besser an den Neumarkt anzubinden.
Das goldene, barocke Zeitalter konzentrierte sich in diesem Quartier
mit der glanzvollen neuen Frauenkirche nach ganz anderen Gestaltungsidealen.
Einzig der Umbau des kurfürstlichen Stallgebäudes durch
Fürstenhof und Knöffel mit der festlichen Freitreppe gelang,
der dem Jüdenhof nun auch in der nördlichen Platzwand eine
geschlossenere Wirkung verschaffte.
Krieg und Frieden - Eirene und Viktoria
Den Jüdenhof- Platz schmückte ab 1867
ein achteckiger Brunnentrog (ursprünglich mit einer Friedensgöttin),
der heute noch vorhanden ist. Der Brunnen stammte bereits von 1649
(er wurde wegen des Denkmals Friedrich August II von dessen Standort
zum Jüdenhof umgestellt). Die
Wasserquelle mit der griechischen Friedensgöttin Eirene, aus
Dankbarkeit für den mit der Beendigung des Dreißigjährigen
Krieges wiedererlangten Frieden vom Dresdner Stadtrat errichtet, trug
auf einem Schild den lateinischen Spruch: "Der Du den Frieden
liebst, lies: Ich bin die Eirende, die Göttin des Friedens, die
den Kriegsgott Mars besiegt hat. Ich eröffne den Quell, damit
er fließe für den Frieden, so wie dies der Rat der Stadt
und die Bürgerschaft von Dresden gelobte." Diese Inschrift
der alten Eirene wurde bei der Restaurierung 1986 im Angesicht der
Kriegsruinen an die Figur der seit 1683 aufgestellten Viktoria (Sieg
und Befreiung Wiens von den Türken) aufgemeißelt.

Jüdenhof um
1900. Blick zum Dinglingerhaus und in die Sporergasse.

Blick auf Neumarkt und Jüdenhof vor der Zerstörung
Vergrößerung


Der Jüdenhof mit der mittelalterlichen Stadtmauer, die die Kolonialstadt
von der Frauenvorstadt bis Mitte des 16. Jahrhunderts trennte. Oliv:
Renaissance-Gewandhaus, teilweise auf den Fundamenten der Alten Synagoge.
Das mittelalterliche Jüdenhaus lag diesseits der Stadtmauer in
einem vermutlich langgestreckten Gebäude. Möglicherweise
sind direkt unter dem Platz Jüdenhof letzte Fundamente der alten
Synagoge zu finden.
19./20.
Jahrhundert
Nach dem Abriss
des alten Gewandhauses und der Neugestaltung der Ecke Neumarkt/Jüdenhof
blieb der Platz bis zum 13. Februar 1945 im wesentlichen unverändert.
Die einzige größere Umgestaltung erfolgte durch den Umbau
des ehem. Galeriegebäudes zum Johanneum (historisches
Museum) in Neorenaissanceformen.

Nicht ausgeführter Entwurf des neuen Johanneum - unter Abbau
der barocken Freitreppe und Hinzufügung eines kleineren Nebengebäudes
zur Sporergasse + neuer repräsentativer Brunnenanlage. Die Ansicht zum Jüdenhof ist verzerrt dargestellt, um das Gebäude besser ins Blickfeld zu rücken.

Johanneum - Freitreppe. Blick zum Dinglinger Haus. Die beiden neobarocken
Kinderfiguren am Eingang (ein chinesischer und europäischer Knabe
mit Porzellangefäßen) sind Werke von Christian Behrens
1876.
Eine weitere,
kunsthistorisch bedeutsame Umgestaltung war der Ladeneinbau für
das Geschäft des königlich sächsischen Hofjuweliers Moritz
Elimeyer durch Gottfried Semper.
 Der
Einbau der Ladenfront erfolgte um 1840, einige Zeit nach Abbruch des
alten Gewandhauses. Das mächtige Gebäude mit einer achtzehnachsigen
Front zum Neumarkt und fünf Achsen zum Jüdenhof, diente Semper dazu
eine durch und durch architektonische Variante mit einem Pfeiler-Architravsystem
für seinerzeit mehr als 10 Geschäfte zu präsentieren. Seine Lösung
in den Formen der italienischen Renaissance war ein beispielhafter
und in außergewöhnlich hoher Qualität ausgeführter Entwurf für eine
Geschäftsausstattung, bei der Architektur, Kunst und Präsentation
des Geschäfts eine Einheit bilden. - Weitere Infos siehe: Presseerklärung
der GHND zum Architekturwettbewerb „Neubau Gewandhaus“, Mai 2006 Der
Einbau der Ladenfront erfolgte um 1840, einige Zeit nach Abbruch des
alten Gewandhauses. Das mächtige Gebäude mit einer achtzehnachsigen
Front zum Neumarkt und fünf Achsen zum Jüdenhof, diente Semper dazu
eine durch und durch architektonische Variante mit einem Pfeiler-Architravsystem
für seinerzeit mehr als 10 Geschäfte zu präsentieren. Seine Lösung
in den Formen der italienischen Renaissance war ein beispielhafter
und in außergewöhnlich hoher Qualität ausgeführter Entwurf für eine
Geschäftsausstattung, bei der Architektur, Kunst und Präsentation
des Geschäfts eine Einheit bilden. - Weitere Infos siehe: Presseerklärung
der GHND zum Architekturwettbewerb „Neubau Gewandhaus“, Mai 2006
Moritz Elimeyer war 1856 bis 1909 königlich- sächsischer
Hofjuwelier in Dresden und Hoflieferant. 1847 bis 1886 auch Juwelier
seiner Majestät des Königs von England, Herzogl. Sachsen
Coburg und Gothaischer Hof Juwelier. Bevorzugt für die Anfertigung
von Brillanten und Dekorationen. 1910 Übernahme durch den Goldschmied
Jordan.
Moritz Elimeyer
war Mitglied der Jüdischen Gemeinde von Dresden. Unter anderem
unterstützte er als beratender Kommissar den Bau der neuen Semper-Synagoge.
(siehe: Emil Lehmann, Ein Halbjahrhundert in der israelischen
Religionsgemeinschaft zu Dresden. Dresden 1890)

Jüdenhof um
1910
In nationalsozialistischer Zeit wurde der der Platzname "Jüdenhof"
aus ideologischen Gründen aufgegeben und an den Neumarkt angliedert.
Erst 1991 erhielt der Platz wieder seinen angestammten Namen, nachdem
er jahrzehntelang völlig unbeachtet in der Dresdner Stadtplanung
ein Schattendasein fristete und überformt werden sollte.
Ab 1938 wurden auch in Dresden sogenannte "Judenhäuser" eingerichtet, um die ihres Besitzes beraubten jüdischen Bürger im Sammelquartiere zusammen zu pressen. Später wurden sie in die Vernichtungslager geschickt. Eines dieser "Judenhäuser" war das Triersche Haus an der Sporergasse. Die GHND setzte sich für die Erhaltung des Kellergewölbes als Gedenktstätte für die Juden-Deportation ein, aber der Bauherr ließ 2014 alle Keller wegbaggern. PM der GHND vom 15.01.2014

Jüdenhof Südseite,
Blick vom Johanneum auf das Regimentshaus (Mitte),
links Galeriestraße, die - nach den jetzigen Plänen des
Stadtplanungsamtes
auf die Wand der Kulturpalastrückseite zuführen würde.

Postkarte um 1900 vom Gasthaus "Burgkeller" am Jüdenhof
(Vergrößerung)
Interessant ist neben dem Personal insbesonder auch das Innengewölbe.
|
| |
Material:
Diamant, Adolf:
Chronik der Juden in Dresden. Von den ersten Juden bis zur Blüte
der Gemeinde und deren Ausrottung, Darmstadt 1973
Haslinger, Sylvia: Die
Juden in der mittelalterlichen Stadt, Universität Salzburg 1999.
Herzig, Stefan: Hauptwache und Altes Gewandhaus, unveröffentlichtes
Manuskript, Dresden 1999
Seiferth, Wolfgang: Synagoge und Kirche im Mittelalter, München, 1964
Geschichte
der Synagoge - zur Einweihung der neuen Dresdner Synagoge - vom
MDR
Jüdisches Museum in Berlin: www.jmberlin.de
- Unter dem Punkt Ausstellung finden Sie eine kurze Zusammenfassung
über jüdische Geschichte in Deutschland.
HATiKVA – die Bildungs- und Begegnungsstätte für jüdische Geschichte
und Kultur Sachsen e.V. - www.hatikva.de
Synagogen in Deutschland - Eine Virtuelle
Rekonstruktion (An der TU Darmstadt, Fachgebiet CAD in der Architektur,
werden seit 1995 Synagogen, die 1938 von den Nazis zerstört worden
sind, am Computer rekonstruiert.)
Speyer
Grabungskakampagne in der mittelalterlichen
Synagoge zu Speyer im Frühling 2001
(Die Speyerer Synagoge ist der älteste aufrecht stehende jüdische
Kultbau in Mitteleuropa. Jahrhundertelang wurde ihre Ruine für profane
Zwecke genutzt, der Bau und seine Ausstattung wurden dabei vielfach
verändert und zum Teil zerstört.)
Wien
Auch Wien hat am Judenplatz gegraben und dort 1995 "Fundamente
von Wiens ältester Synagoge aus dem Mittelalter gefunden und freigelegt.
Diese Synagoge soll eine der größten in Europa gewesen sein, Mittelpunkt
des jüdischen Viertels der Altstadt. 1421, in einer Periode voller
Katastrophen und Epidemien, wurden die Wiener Juden vertrieben, ihr
Viertel, ihre Synagoge vernichtet. Die wenigen Reste, die nun beim
Bau des Museums gefunden wurden, sind ausgestellt - nichts Spektakuläres,
aber berührende Zeugnisse dieser Zeit." Link
zum Museum am Judenplatz
 Frankfurt
Main Frankfurt
Main
Nach umfangreichen Grabungen an der Jüdengasse konnten freigelegte
archäologische Reste des ehemaligen jüdischen Viertels 1992
in einer Dependance des Jüdischen Museums der Öffentlichkeite
gezeigt werden. Dazu gehören die Grundmauern von fünf Wohnhäusern,
zwei Ritualbädern, zwei Brunnen und einem Kanal. Sie stammen überwiegend
aus dem 18. Jahrhundert, die ältesten Teile reichen jedoch bis in
das 15. Jahrhundert zurück. Um die Ruinen herum erläutern Ausstellungen
die Geschichte des Ghettos und das alltägliche Leben in den Häusern
der Judengasse.
Link zum Museum Judengasse Frankfurt
Rothenburg
Eine ausführliche Webseite zur "Zur
Geschichte der Juden im spätmittelalterlichen Rothenburg o.d.
Tauber" mit umfangreicher Bibliographie
 Prag Prag
In Prag befindet sich die älteste erhaltene Synagoge in Mitteleuropa
(Altneusynagoge). Frühgotischer Bau vom Ende des 13. Jahrhunderts
mit reicher steinmetzartiger Ausschmückung und altertümlicher Innenausstattung
(Bild rechts)
Worms
Die Wormser Synagoge mit einer über 1000 jährigen Geschichte,
in der Reichskristallnacht 1938 zerstört, wurde 1961 unter Verwendung
von Originalteilen aus dem 12. Jahrhundert rekonstruiert. Näheres
Ghetto:
[evtl. aus dem Ital. - getto = Gießerei (wegen der Nachbarschaft
des ersten in Venedig belegten Judenviertels zu einer Kanonengießerei,
nach der dieser Stadtteil schon vorher geheißen haben könnte)
Im Mittelalter abgeschlossenes Stadtviertel, in dem die jüdische
Bevölkerung abgetrennt von der übrigen Bevölkerung
leben mußte. Den Juden angewiesenes Viertel, streng abgesonderter,
verschließbarer Wohnsitz der Juden.
Judengasse
"Seit der Antike lebten die Juden auf eigene Initiative in Städten
in separaten Bezirken, um ungestört ihren religiösen und kulturellen
Bräuchen nachgehen zu können. Diese Bereiche waren jedoch nicht strikt
abgetrennt von den übrigen Stadtvierteln. Im Mittelalter lebten Juden
auch außerhalb von ihnen, wie umgekehrt Christen in jüdischen Bezirken
lebten. Seit dem Hochmittelalter folgten dann auch kirchenrechtlich
beeinflußte Bestrebungen, die Wohnräume von Juden und Christen zu
trennen. Im Spätmittelalter wiesen die Städte den Juden häufig feste
Wohnplätze zu, meist in sogenannten Judengassen, die sich manchmal
in peripherer Lage zum Stadtzentrum befanden. Diese dürfen nicht mit
den seit der Frühneuzeit belegten Ghettos verwechselt werden, da es
keine Sperrbezirke mit gefängnisähnlichem Charakter waren." Textquelle:
Rothenburg
"Schwarzer Tod"
Die in MItteleuropa zwischen 1348 und 1350 wütende Pest war ein
ausschlaggebender Grund, warum Juden in ganz Europa im 14. und 15.
Jahrhundert aus irrationaler Angst der Christen verfolgt und ausgegrenzt
wurden. Die Juden wurden in abgesonderte Wohnviertel verwiesen. Sie
mußten spezielle Kleidung tragen (z.B. den zuckerhutähnlichen,
spitzen, gelben Judenhut) und waren ausgeschlossen vom Bürgerrecht
und Grundbesitz.
Der ganze Hof duftete - von Ludwig Richter (1803- 1884)
"Der alte Großvater Richter wohnte in einem engen, düsteren
Hofe eines Hauses hinter der Frauenkirche. Eine Treppe hoch war in
diesem Hinterhause eine Judenschule, und zur Zeit der langen Nacht
lauschte ich oft an der Tür und sah in dem erhellten Raume die
Leute in ihren weißen Sterbekitteln sich neigen und beugen und,
sonderbar klingende Laute ausstoßend, beten. Am Laubhüttenfeste
war das enge Höfchen mit Tannenreisern und Laubwerk überdeckt
und das Volk Israel im bunten, reichen Festgewande saß schmausend
und plaudernd darunter. Der ganzen Hof duftete nach Majoran und anderen
Wurzkräutern, nach Backwerk und Gebratenem."
Ludwig Richter: Lebenserinnerung eines deutschen Malers,
Berlin 1886
|

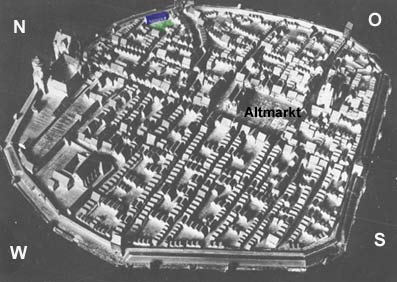


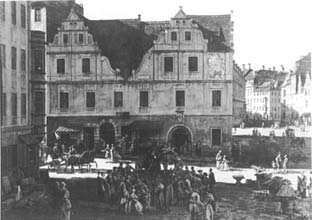
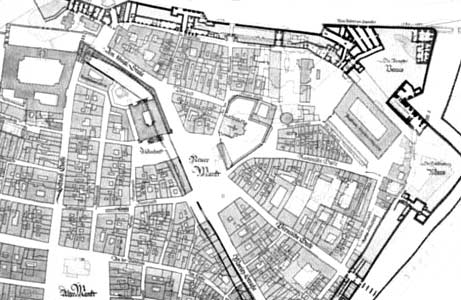
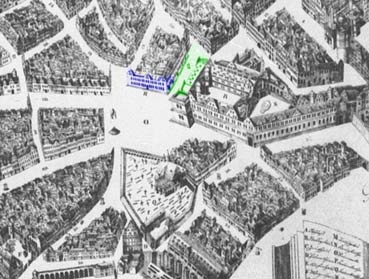





 Der
Einbau der Ladenfront erfolgte um 1840, einige Zeit nach Abbruch des
alten Gewandhauses. Das mächtige Gebäude mit einer achtzehnachsigen
Front zum Neumarkt und fünf Achsen zum Jüdenhof, diente Semper dazu
eine durch und durch architektonische Variante mit einem Pfeiler-Architravsystem
für seinerzeit mehr als 10 Geschäfte zu präsentieren. Seine Lösung
in den Formen der italienischen Renaissance war ein beispielhafter
und in außergewöhnlich hoher Qualität ausgeführter Entwurf für eine
Geschäftsausstattung, bei der Architektur, Kunst und Präsentation
des Geschäfts eine Einheit bilden. - Weitere Infos siehe:
Der
Einbau der Ladenfront erfolgte um 1840, einige Zeit nach Abbruch des
alten Gewandhauses. Das mächtige Gebäude mit einer achtzehnachsigen
Front zum Neumarkt und fünf Achsen zum Jüdenhof, diente Semper dazu
eine durch und durch architektonische Variante mit einem Pfeiler-Architravsystem
für seinerzeit mehr als 10 Geschäfte zu präsentieren. Seine Lösung
in den Formen der italienischen Renaissance war ein beispielhafter
und in außergewöhnlich hoher Qualität ausgeführter Entwurf für eine
Geschäftsausstattung, bei der Architektur, Kunst und Präsentation
des Geschäfts eine Einheit bilden. - Weitere Infos siehe: 


 Frankfurt
Main
Frankfurt
Main Prag
Prag